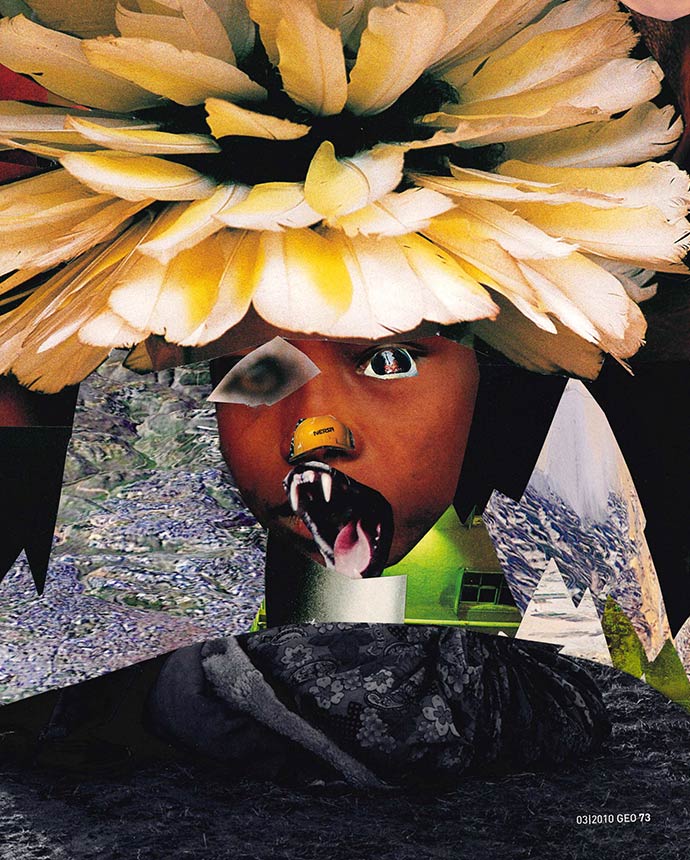Erinnerungen machen Schule
Was zieht den Täter – und durchaus auch die Täterin (obwohl, wenn es um Verbrechen geht, in der Regel nicht gegendert wird) – an den Tatort zurück? Was führt den schulmüden Bengel oder die aufmüpfige Göre dazu, Lehrer oder Lehrerin zu werden? Welche prägenden Erinnerungen an ihre eigene Schulzeit halten Lehrpersonen in spontan abrufbarer Erinnerung bereit, wenn sie danach gefragt werden? Das sind die Fragen, die dieser Sondage im Lehrkollegium der KZI zugrunde liegen.
Natürlich waren sie nicht alle schulmüde Bengel oder aufmüpfige Gören. Oft gingen sie gerne zur Schule und waren grundsätzlich interessiert an dem, was ihnen dort hätte geboten werden können, aber nicht immer im Programm war. Anscheinend wurde in der Schule oft anderes vermittelt als der im Curriculum vorgeschriebene Stoff und ebenso hatten Lehrer und Lehrerinnen auch früher zuweilen seltsame Marotten, die sie an ihren Zöglingen rücksichtslos auslebten. Kurz: An Zürcher und anderen Gymnasien ging es manchmal lustig, kurios oder befremdlich zu und her.
Der Aufruf an meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen hat Erstaunliches zutage gefördert, mich beim Lesen schmunzeln, laut auflachen oder ungläubig den Kopf schütteln lassen. Es gibt auch besondere Momente der Gemeinschaft und Momente, die zum Träumen verleiten.
Wenn ich die Einsendungen hier teile, dann nur unter dem Mantel der Anonymität, sowie zuversichtlich, dass heute alles besser ist bzw. auch die eingefleischtesten Macken des ehemaligen Schülers oder der damaligen Schülerin in der heutigen KZI-Lehrperson zu Weisheit, Sanftmut und moralischer Stärke geführt haben. So lasse ich dieses Akkordeon sich entfalten und wünsche gute Unterhaltung.

Erinnerungen an die Projektwoche meiner Maturklasse an der KWI:
September 1990, ein Lagerhaus ausserhalb von Neuchâtel inmitten von Maisfeldern und von viel Wald umgeben. Das war der Ort, den unsere Französischlehrerin und unser BG-Lehrer für unsere Projektwoche ausgesucht hatten: möglichst abgelegen, weit entfernt von jeglichem Nachtleben und – das dachten sie – die ideale Umgebung für das Projekt unseres Fotoromans «Une femme et deux hommes, qu’est-ce que ça donne?»
Der Kern des Romans hätte eine parodierte Liebesgeschichte werden sollen, aber leider entstand zwischen den beiden Hauptdarstellern eine echte Liebesbeziehung, was das ganze Schaffen erheblich erschwerte. Die Fiktion griff auf die Realität über!
Trotzdem hatten wir unglaublich viel Spass: Wir waren während dieser einen Woche Drehbuchautoren, Lektorinnen, Schauspieler, Bühnenbildnerinnen, Maskenbildner, Kostümbildner, Fotografinnen, kritische Zuschauer und nicht zuletzt Kolleginnen, Freunde, Berater, Vertraute, aber auch Konkurrentinnen.
Eine Nacht blieb mir besonders in Erinnerung. Das abgeschiedene Lagerhaus hielt uns nicht davon ab, uns als ganze Klasse heimlich auf den Weg durch den dunklen Wald ins Städtchen Neuchâtel zu begeben. Wie und wann wir es zu unseren Lagerleitern zurückgeschafft hatten, bleibt unser Geheimnis.

Mein Musiklehrer im Gymi, der auch mein Klavierlehrer war, setzte mich jeweils als seinen persönlichen Butler ein und schickte mich in fast jeder Lektion entweder zu seinem Auto, um ihm den vergessenen Aktenkoffer oder ein Bündel Noten aus dem Kofferraum zu holen, oder beauftragte mich, impromptu mit seinem Kopierschlüssel noch ein Arbeitsblatt für ihn auf dem Flur kopieren zu gehen. Ich brauchte dann immer etwas länger als nötig und genoss einen Augenblick exklusiver Freiheit gegenüber meinen Klassengspänli.

Ich besuchte das Gymnasium Kirchenfeld in Bern mit dem Schwerpunktfach Musik. Ich freute mich eigentlich auf fast jede der fünf Schwerpunktfachlektionen, ausser auf klassische Musikgeschichte. Das Highlight war jedoch immer die Lektion, in der wir 45 Minuten lang sangen – Lieder aus der Renaissance bis hin zu Jazz oder Pop. Wir studierten diese Lieder für den Schwerpunktfachchor ein. Sobald unser Musiklehrer von unserem mehrstimmigen Gesang überzeugt war, verliessen wir das Musikzimmer und sangen eine Auswahl der Lieder a cappella, nur begleitet vom wunderschönen Hall des Schulhauses. Das waren echte Hühnerhaut-Momente.
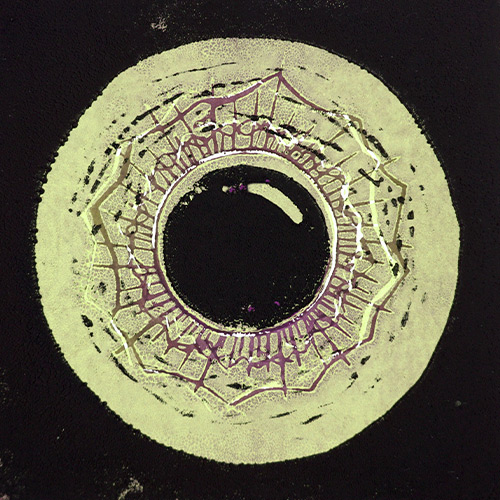
Meine Erinnerung an unseren sehr alten Geschichtslehrer im Untergymnasium stimmt mich hinsichtlich der kleinen Streiche meiner Klassen milde.
Damals bestand unsere Lieblingsbeschäftigung im Geschichtsunterricht darin, mit selbstgebauten Spuckrohren aus ausgehöhlten Stabilo-Stiften kleine Kügelchen durch die Klasse zu spicken. Auch Papierflieger aller Gattungen wussten wir zu basteln. Immer, wenn der Lehrer uns den Rücken zudrehte, ging das Spiel los. Er hörte nicht mehr besonders gut und konnte wohl auch nicht mehr allzu gut sehen. So bemerkte er nicht einmal, wenn wir unter den Tischen zu unseren Sitznachbarn krochen. Die Herausforderung, nicht erwischt zu werden, stärkte unsere Klassensolidarität ungemein.
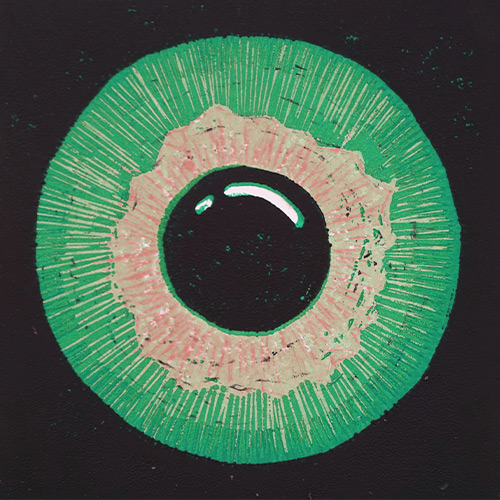
Situation 1: Sind Lehrer bestechlich?
Unser Lateinlehrer war Deutsch-Amerikaner. Mit Cadillac, Anzug und Texas-Krawatte. Eine Persönlichkeit, die man nicht so schnell vergisst.
Unser Klassenchef, unterdessen auch Lehrer geworden, hatte im Jahr 1992 die Idee, für unseren Lateinlehrer einige Ostereier im Schulgarten zu verstecken.
Sichtlich gerührt begab sich unser Lehrer mit den polierten Lederschuhen und der ganzen Klasse durch das Schulbiotop der Kantonsschule Im Lee in Winterthur und fand mit unserer Hilfe alle 6 Eier. Klassenschnitt nächste Prüfung: 5.5. Zufall?
Situation 2: Streiche spielen mit einseitigem Vergnügen
Wir schreiben das Jahr 1994. Kantonsschule Im Lee, Winterthur. Unser Deutschlehrer begab sich aufgrund einer Lebenskrise in einen Semesterurlaub. Es kam Frau D. Und wie sie kam! Direkt von der Uni, ehemalige Schülerin vom Lee, Klassenbeste, resolut, emanzipiert, feministisch, im Kostüm mit Manager-Köfferchen und immer penetrant gut vorbereitet.
Leider versuchte sie in jeder Lektion vorzuführen, dass Mädchen den Jungs intellektuell im Prinzip überlegen seien.
Wir waren dummerweise Jungs, und fanden das so mittel.
Thomas brachte die Turntasche. Darin eine 12V-Autobatterie, gut getarnt, vor der Lektion perfekt an der Zimmertüre platziert und mit Drähten an die Türfalle angeschlossen: sozusagen ein Kuhdraht für die angemessene Begrüssung unserer lieben Frau D. Beherrscht wie sie war, liess sie sich nach dem Stromschlag nichts anmerken, war aber die ganze Lektion hindurch sehr schlecht gelaunt.
Das war uns dann doch etwas zu wenig.
Nächster Streich: Von allen Klassen auf dem Stockwerk die Bleistiftspitzer-Abfälle emsig eingesammelt in einem Sack, rein damit in den Abfallkorb des Schulzimmers. Aber darunter ein kleiner Sprengsatz aus dem Chemie-Labor-Koffer von Thomas. Das war sein Hobby (seines Zeichens heute Sprengstoffexperte bei der Kantonspolizei). Gut getarnte Kabel hurtig zum Schülerpult gelegt, und bereit: Frau D. an der Tafel neben dem Kübel. WUMS. Keine Frau D. mehr, nur noch eine grosse Wolke Spitzerabfallstaub.
Das führte aber zu einem Besuch beim Rektor, der uns ins Gewissen redete und dabei bei allem gespielten Ernst seine zum leichten Schmunzeln zuckenden Mundwinkel nur knapp kontrollieren konnte.

Eine unvergessliche Erinnerung an meine Mittelschulzeit betrifft den Klassenaustauch, den unsere Schulklasse im Jahr 1991, kurz nach dem Fall der Berliner Mauer, mit einer polnischen Klasse in Wroclav durchführte. Wir reisten im Frühling nach Polen und wurden bei den Familien der Klasse untergebracht. Eine Woche lang tauchten wir in eine ganz andere Welt ein. Im September besuchte uns die polnische Klasse dann in Lugano, wo wir für sie eine spannende Woche organisierten. Es war ein sehr bereicherndes Erlebnis!
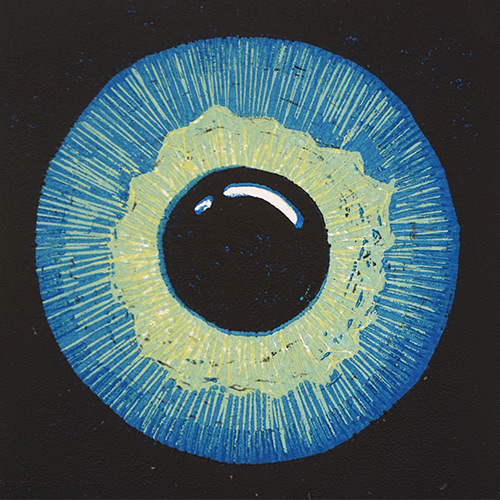
Anno 1991 – ein Jahr, das die Welt veränderte…
1991 wird die Weltkarte mit der Auflösung der Sowjetunion mehr oder weniger neu gezeichnet: Staaten wie Litauen, Lettland und Estland, aber auch die Ukraine erklären ihre Unabhängigkeit von der UdSSR und Boris Jelzin wird in freien Wahlen zum ersten Präsidenten Russlands gewählt.
1991 gilt aber auch als Geburtsjahr des World Wide Web (WWW): Am 6. August 1991 macht nämlich der Informatiker Tim Berners-Lee die erste Webseite öffentlich zugänglich. Ohne seine Bemühungen für die breite Allgemeinheit wäre die Welt heute eine andere.
Und 1991 beschliesst das Schweizer Stimmvolk die Herabsetzung des Stimm- und Wahlrechtsalters auf 18 Jahre. Ausserdem wird der Ötzi entdeckt. Und ich werde endlich 18 Jahre alt! Und damit erwachsen und Frau genug, überall mitzureden und alles anzuzweifeln, was mir meine Erzieher (es sind zu der Zeit am Kollegium Schwyz wirklich fast nur Männer) weismachen wollen. Zum Beispiel, dass Frauen an den Herd und nicht in den Philosophieunterricht gehören.
Philosophie war damals Maturfach und damit obligatorisch für alle Schüler und Schülerinnen. Als literarisch interessierte junge Frau freute ich mich auf dieses Fach, doch die Freude sollte mir schon bald vergehen. Unser Philosophielehrer nämlich – ein Pater alter Schule, Thomist und in brauner Kutte – sprach grundsätzlich nur mit dem männlichen Teil der Klasse, Frauen existierten in seiner Welt nicht. So sehr ich mich auch bemühte und versuchte, am Unterrichtsgespräch teilzunehmen, ich wurde nicht gesehen. Natürlich konnte ich mich damit nicht abfinden und so begann ich, nun für alle hörbar, mit den Fingern zu schnippen, um mich bemerkbar zu machen. – Nichts. – Schnippen. – Keine Reaktion. – Stärkeres Schnippen. – Und dann schnauzt mich der Pater endlich an: «Was macht Tochter hier? Frauen gehören an den Herd und nicht in den Philosophieunterricht!» Ohne zu zögern, packe ich meine Sachen zusammen, stehe auf und verlasse das Schulzimmer.
Als ich dann abends nach Hause kam, wartete schon mein Vater auf mich: «Was hast du jetzt wieder angestellt?» Der Rektor habe ihn bei der Arbeit angerufen und ich dürfe erst wieder in den Philosophieunterricht, wenn ich mich schriftlich beim Pater entschuldigt hätte. Und ich wisse ja bestimmt, dass Philosophie obligatorisches Maturfach sei und ich ansonsten nicht zur Matur zugelassen werden könne.
Nachdem ich meinem Vater dann die Geschichte aus meiner Perspektive geschildert hatte, meldete er sich anderntags beim Rektor und stellte klar, wer sich bei wem entschuldigen müsse. Ansonsten würde der Fall öffentlich gemacht.
Eine negative Publicity konnte sich die Schule wohl nicht leisten, und so «durfte» ich einige Wochen später wieder in den Philosophieunterricht, auch ohne Entschuldigung. In meinem Zeugnis ist diese Episode aber immer noch ersichtlich: Betragen ungenügend!

Deutschunterricht: Wir haben gerade unsere Aufsätze zurückerhalten. Frau B. erläutert ihren Gesamteindruck.
Ich, 16, erstaunt über meine geringe Anzahl Fehler und wenig interessiert an Frau B.s Ausführungen, tuschle mit meiner Banknachbarin.
Frau B.: N., hast du uns etwas mitzuteilen?
Klein N.: Öh, nein, ich bin nur erstaunt über meine geringe Fehlerzahl.
Frau B.: Ja, ich auch.
Die Klasse raunt, ich blicke Frau B. verdutzt an, sie lächelt verschmitzt.
Ich weiss nicht, wieso ich mich heute noch an diese kleine Episode erinnern kann. Irgendwie sass diese Antwort.
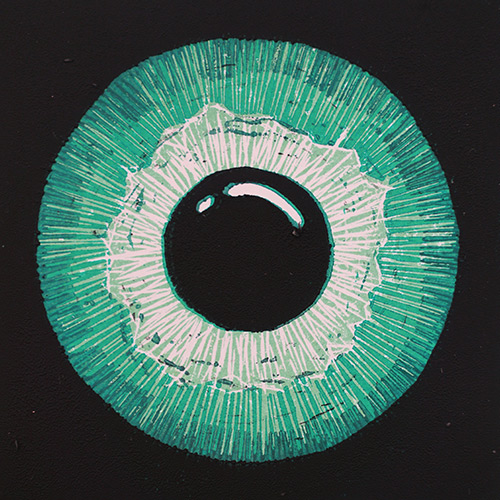
Während meiner Gymi-Zeit habe ich vieles erlebt und mir einiges «geleistet». Hier eine kleine Blüte meines damaligen Wirkens:
Als ich die Kantonsschule besuchte, war das Internet noch neu und Plagiate auf gymnasialer Stufe waren noch kein Thema. Mein damaliger Geschichtslehrer war sehr vielseitig engagiert und optimierte seinen Unterricht, indem er uns für die vielen ausgefallenen Lektionen schriftliche Arbeiten über eine historische Person verfassen liess. Die Auswahl fiel mir leicht: Ich wählte Niccolò Machiavelli. Nicht aus besonderem Interesse, sondern schlicht, weil mein grosser Bruder zwei Klassen weiter oben dasselbe tat.
Dabei waren zwei Dinge besonders pikant: 1. Er reichte seine Machiavelli-Arbeit beim gleichen Lehrer zur gleichen Zeit ein. 2. Die Arbeit stammte auch nicht von ihm, sondern von einer damals frisch entstandenen Hausaufgabenhilfswebseite. Bei dieser Ausgangslage gäbe es heute wohl ungenügende Noten und disziplinarische Massnahmen. Damals aber wurde mein Bruder dank seines Rufs eines Musterschülers mit einer Note 6 belohnt, während ich mich mit einer 4.5 zufriedengeben durfte. Während ich damals vor Wut kochte, freuen wir uns heute noch gelegentlich gemeinsam über unsere dreiste Tat. Ob die Tat unerkannt blieb, ist nicht ganz klar, denn kurz danach setzte sich unser Lehrer stark für die Verfolgung von Plagiaten an der Schule ein. Und die grosse Ironie am Ganzen ist, dass mein Bruder und ich uns heute beide als Gymnasiallehrpersonen mit KI-generierten Textplagiaten herumschlagen müssen.
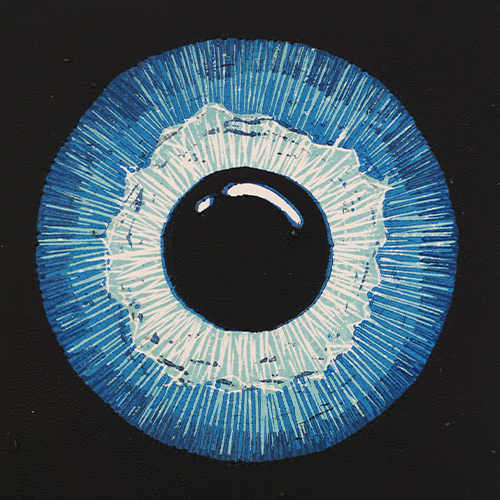
Ich erinnere mich noch gut an meine Zeit in der SO der Kanti Wiedikon. Damals musste man sich für einen Platz im SO-Vorstand bewerben und ein Plakat gestalten. Meine Klassenkollegen meinten, ich solle es versuchen, und so habe ich eher aus Spass ein Wahlplakat gemacht mit ein paar Ideen zur Verbesserung der KWI. Mein Hauptversprechen war dabei, das Atrium in ein Delfinbecken umzubauen.
Ich war überzeugt, dass ich sowieso nicht gewählt werde, aber überraschenderweise hat es dann doch geklappt. Das Delfinbecken gibt es leider bis heute nicht. Deshalb bin ich dabei, die Projekteingabe für die KZI vorzubereiten.
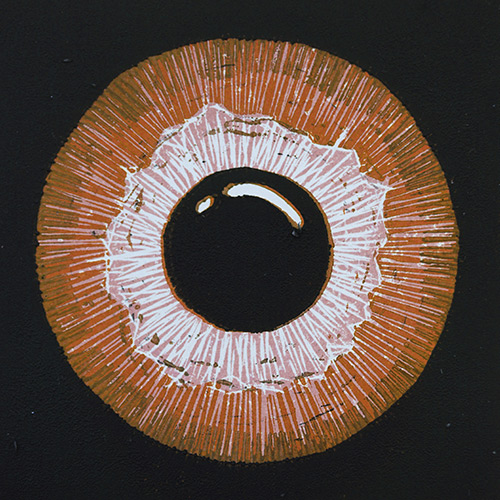
Viele Highlights:
Es gab viele kleine Highlights während meiner Schulzeit. Einige davon gehen auf das Konto unseres Biologielehrers (vielleicht mit ein Grund für meine spätere Studienwahl?). Einmal haute ihm während des Unterrichts ein Regenwurm ab, was für grosse Aufregung sorgte. Ein anderes Mal suchte unser Lehrer während einer ganzen Lektion nach der Fernbedienung des DVD-Geräts und rannte wiederholt aus dem Zimmer, weil ihm ein neuer Ort eingefallen war, wo er sie vielleicht verlegt hatte. Nur: Da war sie leider auch nicht.
Ein Lowlight:
Meine Mathe-Lehrerin im Obergymi war der Meinung, dass das Repetieren des Stoffs essenziell sei, um Fortschritte zu machen und den Stoff wirklich zu verstehen. Das bedeutete, dass am Anfang jeder (!) Lektion eine Schülerin bzw. ein Schüler vor der ganzen Klasse 20 Minuten lang mündlich und notenrelevant geprüft wurde. Natürlich verlangsamte das unser Vorwärtskommen dramatisch, was uns dann ebenfalls vorgehalten wurde. Weil wir als Klasse mit Neusprachlichem Profil in Mathe nicht gerade leistungsstark waren, stellte unsere Lehrerin dann auch immer wieder infrage, dass wir die Matur bestehen würden. Nach zwei Jahren und unzähligen Gesprächen konnten wir dieses Prüfungsritual abschaffen und haben die Matura alle trotzdem bestanden.
Während meiner Schulzeit war mir dieser Mathe-Unterricht ein Gräuel. Bei den Mathe-Vorlesungen im Studium musste ich dann allerdings feststellen, dass uns unsere Lehrerin extrem gut aufs Studium vorbereitet hatte. Nur schade, hatte es nicht mehr Spass gemacht.

Die Gymi-Zeit verbinde ich mit positiven Emotionen. Die Gründe dafür sind verschieden: eine tolle Klasse, schöne Freundschaften, meist nette und gute Lehrpersonen und ganz ansprechende Noten. Zwei Antihelden gab es allerdings: mein Lateinlehrer und eine Französischlehrerin. In ihren Schulstunden haben wir kaum etwas gelernt, ausser vielleicht nachhaltig zu veranschaulichen, wie sich Antipathie und Desinteresse anfühlen. Es hat mich geärgert, dass wir so viel Zeit vergeudet haben. Aber ich habe aus den Zitronen Limonade gemacht. Diese zwei Antihelden sind zu einem grossen Teil dafür verantwortlich, dass ich heute diesen Beruf ausübe, den ich wirklich gerne mag. Sie haben meinen Ehrgeiz geweckt: Ich wollte es besser machen.
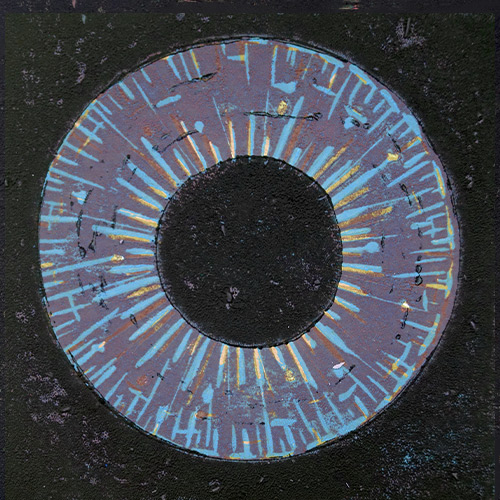
Meine Erinnerung ist leider negativ, obwohl ich im Ganzen eine schöne Schulzeit hatte. Ich war an der KZU Bülach immer eine gute Schülerin, hatte meinen soliden 5er-Schnitt, war im Unterricht engagiert und – abgesehen von ein paar teenie-esken Anfällen von Besserwisserei – wie mir scheint, eine recht angenehme Schülerin. Meine schulischen Leistungen gingen mir relativ leicht von der Hand, ich verbrachte den grössten Teil meiner Zeit neben der Schule in diversen Vereinen (Volleyball, Jazztanz, Theater) und war auch in meinem Freundeskreis sehr aktiv und initiativ.
Mein Klassenlehrer hielt mir jedoch Semester für Semester vor, ich würde mein schulisches Potenzial nicht ausschöpfen und solle doch meine Hobbys etwas zurückfahren und lieber noch mehr für die Schule tun. Das fand ich schon damals daneben, und es ärgert mich noch heute. Wenn ich dem etwas Positives abgewinnen kann, dann wohl den Vorsatz, selbst nie so zu werden und besonders die guten Schülerinnen und Schüler darin zu bestärken, dass es – gerade im Jugendalter – doch noch so viel Anderes, um nicht zu sagen, Wichtigeres im Leben gibt, als ob man jetzt eine 5 oder eine 5.5 im Zeugnis stehen hat.
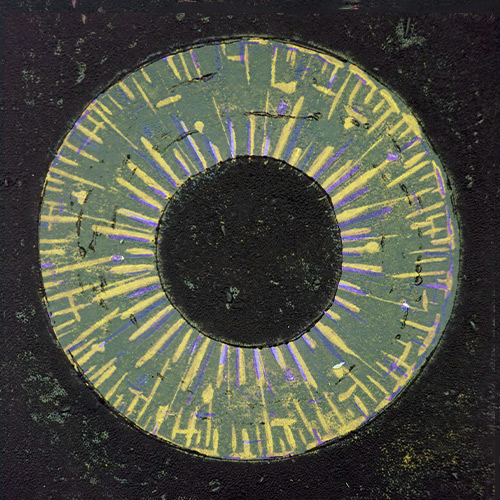
Drei Anekdoten aus meiner Gymnasialzeit fallen mir auf die Schnelle ein:
- Mein Kollege Till war ein Bastler und Löter. Er hat in den Hellraumprojektor (ja, die gab’s damals noch...) einen Kassettenrekorder (die gab’s damals auch noch) eingebaut, der immer, wenn der Projektor angestellt wurde, «Another Brick in the Wall» von Pink Floyd abgespielt hat (man kennt den Text ja). Die erschrockene Reaktion des technisch völlig unbeschlagenen und immer eine Verschwörung gegen sich witternden Deutschlehrers bleibt mir im Gedächtnis...
- Meine Englischlehrerin hatte die unangenehme Angewohnheit, stets die ihrer Meinung nach schlechtesten Essays, die bei einer Hausaufgabe abgegeben wurden, vor der ganzen Klasse (immerhin ohne Namensnennung) vorzulesen und mit einem spöttischen «Haha» zu quittieren. Das hat mich immer wütend gemacht und als mal mein Essay vorgelesen wurde, auch ziemlich gekränkt.
- Mein Lateinlehrer hat in den Lektionen vor den Ferien stets ein Quiz mit der Klasse gemacht. Dabei bleibt mir einerseits seine Aussprache (irgendwie eher so: Kwitz) in Erinnerung, aber mehr noch sein mir bis heute fast unheimlich erscheinendes Allgemeinwissen: Der Kerl wusste wirklich zu praktisch jedem Thema eine treffsichere Frage inkl. Antwort. Ich halte ihn bis heute für einen der am besten allgemeingebildeten Menschen, und würde alle Hebel in Bewegung setzen, ihn ausfindig zu machen, wenn ich mal einen Telefonjoker bei «Wer wird Millionär?» bräuchte.

Wir hatten an der KS Glattal teils Unterricht in alten Baracken. Diese lagen etwas abseits des eigentlichen Schulhauses, wodurch ein Zimmerwechsel in einer kurzen Pause zu einer kleinen Herausforderung wurde. Viel stärker in Erinnerung blieben aber die kalten Wintertage, an denen die Heizung in den Baracken ausgefallen war. Insbesondere unser Biologielehrer versuchte dann, mit einem vorne installierten Bunsenbrenner wenigstens etwas Wärme ins Zimmer zu bringen. Wir schätzten den Einsatz und die Geste. Genützt hat es nicht wirklich, weshalb mir der Unterricht in Winterjacke immer in Erinnerung bleiben wird.