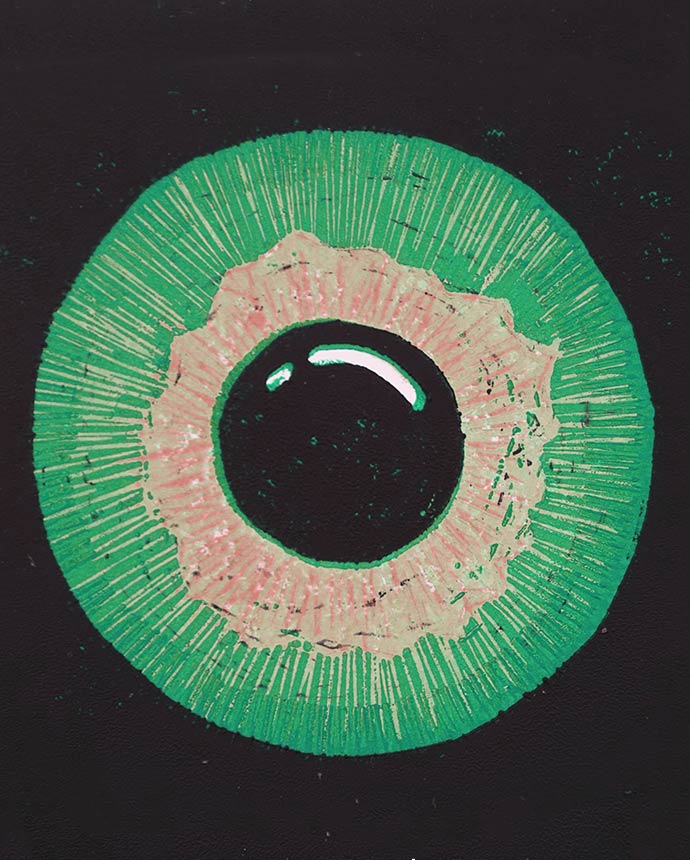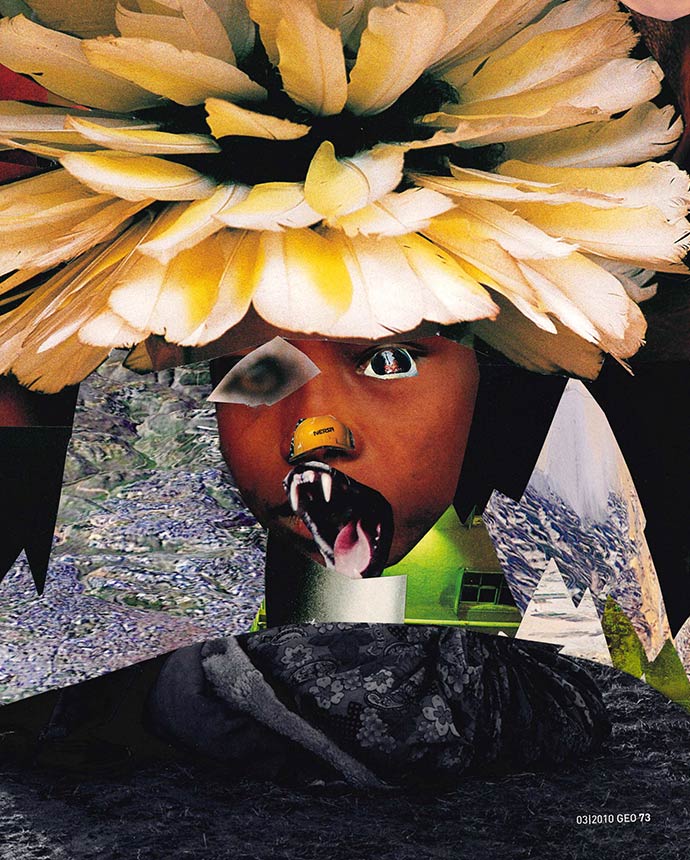Ein Einblick in die Schulentwicklung: Gesundheitsförderung
Was ist die grundlegende Idee hinter der Gesundheitskommission unserer Schule?
Die Schule soll ein Ort sein, an dem Schülerinnen und Schüler befähigt werden, selbstständig Entscheidungen zu treffen und Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Gleichzeitig sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die Gesundheit fördern. Ziel ist eine Schule, die nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch gesund macht.
Wer gehört zur Gesundheitskommission?
Die Kommission ist eine der grösseren an unserer Schule. Mitglieder sind unter anderem Vertreterinnen des Konvents (Frau Lieberherr, Frau Stuber, Frau de Capitani und Frau Erdogu), die Schulärztin Frau Dr. Knobel Rauch, ein Mitglied der Schulleitung sowie Fachpersonen externer Präventionsstellen. Gemeinsam entwickeln und setzen sie das Gesundheitskonzept um.
Welche Rolle spielt die Ernährung?
Gesunde Ernährung ist ein Thema, das in der Hauswirtschaft und im Lehrplan verankert ist. Die Mensa liegt organisatorisch in der Verantwortung der Schulleitung, jedoch kann die Kommission Impulse geben. Entscheidend ist, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, sich eigenverantwortlich gesund zu ernähren – zu Hause, im Alltag und in der Schule.
Wie wird Prävention im Unterricht umgesetzt?
Die Präventionsarbeit ist auf die sechs Schuljahre verteilt:
- 1. und 3. Klasse: Medienprävention sowie Suchtprävention (Risikokompetenz und Lebenskompetenzen).
- 2. Klasse: Sexualaufklärung in Biologie, ergänzt durch externe Fachpersonen, sowie gesunde Ernährung im Rahmen der Hauswirtschaft.
- 2. und 4. Klasse: Sexualpädagogik mit Fokus auf Selbstbestimmung.
- 5. Klasse: Aufklärung über Risiken beim Fahren unter Substanzeinfluss.
- 6. Klasse: keine fixen Präventionsmodule.
Zusätzlich werden jährlich Schwerpunkte gesetzt, etwa zuletzt das Thema Neurodiversität und der Ausbau des Präventionsteams für Sucht und Medien.
Welche Herausforderungen sehen Sie bei Jugendlichen besonders?
Die grösste Herausforderung ist die Identitätsbildung in der Jugendzeit. In dieser Phase sind Schülerinnen und Schüler anfälliger für Krisen. Die Kommission schafft Strukturen, in denen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler als Ansprechpersonen fungieren können. Beispiele für mögliche Schwierigkeiten sind Transidentität, Mobbing, Essstörungen oder Bodytuning. Wichtig ist, dass Betroffene jederzeit wissen, wo sie Hilfe finden.
Mit welchen Themen kommen Jugendliche am häufigsten zu Ihnen als Vertrauenslehrperson?
Häufig geht es um typische «erste Male»: die erste Trennung, der erste schulische Misserfolg oder der erste Kontakt mit Drogen und Alkohol. Diese Situationen sind oft belastend, da sie neu sind. Viele Probleme können vom Umfeld aufgefangen werden; in schwierigen Fällen sind die Vertrauenslehrpersonen da, um Unterstützung zu bieten.
Wie gehen Sie persönlich mit belastenden Fällen um?
Bei schweren Themen wie Suizidalität, Misshandlung oder psychischen Erkrankungen ist professionelle Verarbeitung nötig. Die Bedeutung von Reflexion mit Kolleginnen und Kollegen sowie der Austausch in Fachnetzwerken ist sehr wichtig für uns Beratende. Dies ermöglicht eine professionelle Distanz, ohne die menschliche Seite zu verlieren.
Wie sieht es mit der Gesundheit der Lehrpersonen aus?
Auch Lehrpersonen stehen unter hoher Belastung – ihre effektive Arbeitslast liegt oft bei über 100 Prozent. Umso wichtiger sind Austausch, Feedback und Strukturen, die Ausgleich schaffen. Dazu gehören beispielsweise gesunde Angebote im Teamraum und eine Kultur, die Lehrpersonen langfristig gesund hält. Geht es den Lehrpersonen gut, wird das auch dazu führen, dass es den Schülerinnen und Schülern gut geht – nicht zuletzt, weil der Unterricht dadurch deutlich besser wird.
Welchen Stellenwert hat Feedback?
Feedback ist zentral. Einzelne Präventionsmodule wurden aufgrund von Rückmeldungen mehrfach angepasst oder sogar neu entwickelt. Heute liegen die Bewertungen deutlich höher, was zeigt, dass das System lernfähig ist und sich laufend verbessert.
Welche Kompetenzen sollten in Zukunft stärker gefördert werden?
Lebenskompetenzen sind entscheidend – etwa der Umgang mit Risiken, die Suchtprävention oder der Aufbau einer gesunden Lebensführung. Diese Themen sind bisher nicht systematisch im Curriculum verankert, sollten jedoch als ebenso wichtig angesehen werden wie klassische Schulfächer.
Zum Schluss: Wie würden Sie sich selbst in drei Worten beschreiben?
Humorvoll, effizient, zeitgerecht.

Für Christoph Staub soll die Schule nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch, wie man gesund bleibt.